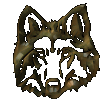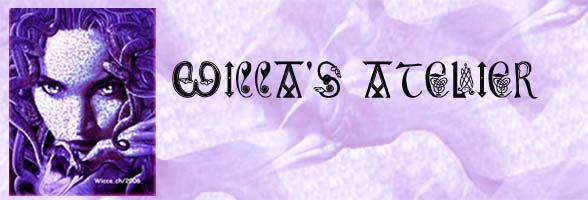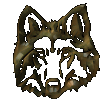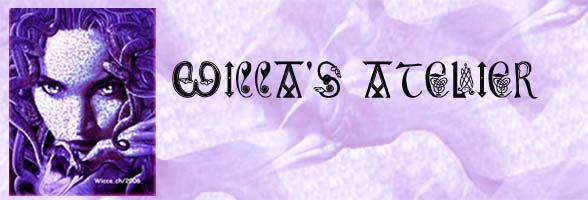Kolkraben Corvus Corax

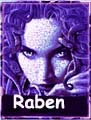
Englisch:
Raven
Französisch: Grand Corbeau
|
Größe:
|
64
cm
|
|
Kennzeichen:
|
Sehr
ähnlich wie Rabenkrähe, aber deutlich größer, bussardgroß.
Gefieder tiefschwarz, blau schillernd, Schnabel sehr kräftig. Keilförmiger
Schwanz.
|
|
Gewicht:
|
-
1250 g
|
|
Stimme:
|
Viele
verschiedene Rufe, mehrmals wiederholt tief und sonor "kraa"
oder "krok", krähenartig
"wärr", hohl "kong"
oder hölzern "k-k" und
stimmlos schnarrend "rrrr"
|
|
Gesang:
|
Bauchrednerartig
aus wiederholten, schwatzenden, plaudernden Motiven
|
|
Verhalten:
|
Sträubt
häufig sein zottiges Kehlgefieder, Flügelschlag wuchtig mit
pfeifendem Fluggeräusch, segelt oft; während der Balz akrobatische
Flugspiele.
|
|
Brut:
|
Februar
- Mai, 3-6 Eier, Brutzeit 20-21 Tage, Nestlingzeit -40 Tage
|
|
Verbreitung:
|
Europa, Asien, N-Afrika, N-Amerika, Grönland
|
Als mißliebiger
Vogel erbarmungslos verfolgt, war der Kolkrabe hierzulande nahezu
ausgerottet. Inzwischen ist seine sonore Stimme wieder häufiger zu hören.
Daß die imposanten schwarzen Vögel nun ebenso unter Schutz stehen wie
Rotkehlchen und Nachtigallen, stößt freilich nicht überall auf
Zustimmung. Bei vielen Landwirten gelten sie als gefährliches Pack, das
mitunter ganz unverfroren junge Kälber angreift und zu Tode hackt. Daß
die Kolkraben hier zu Unrecht beschuldigt werden, zeigten Dieter Wallschläger
und Angelika Brehme vom Institut für Ökologie der Universität Potsdam.
Sie nahmen sich drei Herden vor, von denen mehrfach tote Kälber gemeldet
worden waren. Im Frühjahr 1998 legten sich Mitarbeiter des Instituts dort
einige Wochen auf die Lauer und behielten rund 170 Kühe samt Nachwuchs
von morgens bis abends im Auge. Dabei beobachteten sie, daß die Raben
tatsächlich handgreiflich werden. Sie ziehen die Kälber am Schwanz,
kneifen sie hierhin und dorthin und geben oft keine Ruhe, bis sie von der
Mutterkuh verscheucht werden oder ihr Opfer auf die Beine gebracht haben.
Und damit haben sie gewöhnlich ihr Ziel erreicht, denn beim Aufstehen läßt
das Kalb meist einen Klacks Kot fallen. Auf diese Gabe, so entdeckten die
Potsdamer Wissenschaftler, haben es die Vögel offenbar abgesehen. Solange
ein Kalb vorwiegend von Milch lebt, sind die Überreste seiner Verdauung nämlich
reich an Eiweiß und durchaus nahrhaft.
Größer als ein
Bussard wirken Kolkraben recht bedrohlich. Mit ihrem zwar kräftigen, aber
recht stumpfen Schnabel Können sie gesunde Kälber jedoch nicht ernsthaft
gefährden. Nur kränklichen, von der Mutter im Stich gelassenen Geschöpfen
fügen sie mit ihren hartnäckigen Attacken oft blutende Wunden zu. Nach
Einschätzung der Forscher dürfte ein Landwirt, der täglich nach seinen
Tieren schaut, jedoch keine Mühe haben, ein solches Kalb rechtzeitig in
Sicherheit zu bringen. Wenn ein Tier auf der Weide stirbt, ist freilich
nicht zu erwarten, daß die Raben so eine Mahlzeit verschmähen.
Obwohl sie nicht töten,
bringen die Kolkraben mit ihrer derben Zudringlichkeit zweifellos Unruhe
in die Herde. Außerdem lassen sie sich neben wertlosen Abfällen auch
gerne das für die Kühe bestimmte Kraftfutter schmecken. Findig wie sie
sind, haben sie gelernt, die gängigen Futterautomaten zu plündern.
Deshalb raten die Potsdamer Wissenschaftler, diese Behälter so zu
sichern, daß den ungeladenen Gästen der Zugriff verwehrt bleibt und
nicht zu viele angelockt werden. Wenn die Raben eine Herde dennoch mit
auffallender Ausdauer belagern, ist das nach Ansicht der Forscher ein
ernstzunehmendes Warnsignal. Die Landwirte sollten dann schleunigst nach
dem Rechten sehen, denn wahrscheinlich sind Kälber krank oder vernachlässigt
worden.
Lästig werden Raben
nur dann, wenn sie in Scharen auftreten. Solche Schwärme bestehen aus
jungen Vögeln, die noch keinen Partner gefunden haben und ohne festen
Wohnsitz umherstreifen. Mitglieder dieser Jugendbanden sind ebenso
unternehmung-slustig wie experimentierfreudig. Alles Unbekannte wird gründlich
inspiziert, um genießbare Funde in den Speiseplan einzureihen. Wie Bernd
Heinrich von der University of Vermont beobachtete, interessieren sich
junge Raben ebenso für unscheinbare Objekte wie für auffällig große
oder bunte. Auch gut Getarntes entgeht ihnen nicht. Mühelos entdeckten
sie beispielsweise die Gehäuse von Köcherfliegen, die der Biologe auf
den Waldboden gestreut hatte. Bei näheren Erkundungen merkten sie bald,
daß die Hülle aus ungenießbaren Pflanzenteilen einen schmackhaften
Bissen beherbergt (Animal Behaviour Bd. 50, S. 695).
Diese forschende
Neugier hat dem Kolkraben vermutlich geholfen, ganz verschiedenartige
Lebensräume zu besiedeln. An der Meeresküste ist er ebenso zu Hause wie
im Binnenland, in kargen Steppengebieten ebenso wie in dichten Wäldern.
Und selbst in Kulturlandschaften kommt er offenbar gut zurecht. Je
eifriger die Jungen ihre Umwelt erkunden, desto besser können sie später
das vielfältige Nahrungsangebot ihres jeweiligen Lebensraums ausschöpfen.
Hierzulande sind die Raben nicht nur auf Viehweiden fündig geworden. Sie
stöbern zum Beispiel auch gerne auf Müllkippen nach Eßbarem und machen
sich manchmal dadurch unbeliebt, daß sie auf den Äckern die frisch
gesetzten Kartoffeln wieder ausgraben.
Wenn ein Kolkrabe
erwachsen wird, verliert sich sein unersättliches Interesse an Neuem.
Lernfähigkeit und ein gutes Gedächtnis sind freilich auch weiterhin ein
wichtiges Rüstzeug im Kampf ums überleben. Das zeigten Bernd Heinrich
von der University of Vermont und John W. Pepper von der University of
Michigan, als sie die Vorratshaltung der Kolkraben erforschten (Animal
Behaviour Bd. 56, S. 1083). Die ausgedehnten Waldgebiete des Bundesstaates
Maine bieten eine abwechslungsreiche Kost, die saftige Früchte ebenso
einschließt wie Insekten, Fische und Mäuse. Was Wölfe und andere
Raubtiere bei ihren Mahlzeiten übriglassen, ist ebenfalls eine
willkommene Bereicherung des Speiseplans. In den Wintermonaten ernähren
sich die Raben fast ausschließlich von solchen Überresten. Ähnlich wie
die Geier südlicher Regionen halten sie unermüdlich Ausschau nach toten
Tieren. Doch anders als die Aasfresser wärmerer Klimazonen, können die
Raben in den Wäldern von Maine Vorräte anlegen und tun das auch eifrig.
Wenn sie Fleisch im Überfluß finden, fliegen sie immer wieder mit einem
Brocken davon und vergraben ihn im Schnee. Mindestens zwei Wochen lang, so
das Ergebnis der Wissenschaftler, merken sich die Vögel, wo sie ihre
Speisekammern angelegt haben.
Dank der frostigen
Temperaturen bleiben die Vorräte noch länger genießbar. Doch gewöhnlich
schrumpfen sie trotzdem bald, weil sie von anderen hungrigen Waldbewohnern
aufgespürt werden. Fuchs und Kojote zum Beispiel haben eine gute Nase für
nahrhafte Happen. Die Raben müssen sich dagegen ganz auf ihr Gedächtnis
verlassen. Und wenn sie zusehen konnten, wo ein Artgenosse seinen Proviant
verstaut hat, finden sie auch diese Verstecke wieder. Kein Wunder, daß
Kolkraben sorgsam darauf bedacht sind, neugierigen Blicken zu entgehen.
Wenn sie sich unbeobachtet glauben, legen sie ihre Vorratskammern in der Nähe
des Futterplatzes an. Doch sobald sich fremde Artgenossen dazugesellen,
wird die Beute außer Sichtweite vergraben.
Ein seßhaftes
Rabenpaar tut zweifellos gut daran, Proviant für magere Zeiten zu
sammeln. Warum auch sich unstet umherstreifende Vögel diese Mühe machen,
ist weniger einsichtig. Wenn eine Nahrungsquelle erschöpft ist, zieht die
Schar der Junggesellen weiter, ohne ihre Vorrats-kammern geleert zu haben.
Wahrscheinlich, so die Vermutung der Wissenschaftlern, sind die
versteckten Fleischbrocken eine Reserve für den Notfall, auf die nur ganz
selten zurückgegriffen wird. Wenn ein Rabe sich rundum sattgefressen hat,
kann er ohne weiteres ein wenig von dem forttragen, was sonst anderen
zufallen würde. Entsprechend gering wiegt der Verlust, wenn er die gefüllten
Speisekammern verläßt, um anderswo sein Glück zu suchen. Falls er keine
neuen Fleischberge aufspüren kann, bleibt ihm immer noch die Möglichkeit,
zurückzukehren und sich an den verborgenen Vorräten zu laben.
|